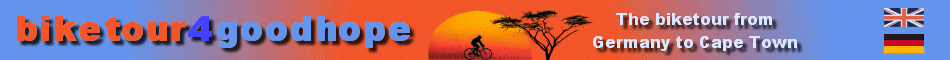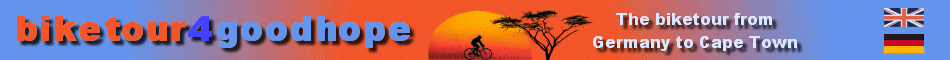|
3/24/2004 Kenia / Nanyuki
Licht und Schatten
Rueckfahrt nach Nanyuki
(Harald) Um vier Uhr plaerrt, quaeckt und knarzt das Megaphon der oertlichen Moschee, der muede Muezzin ist eine Plage seiner Glaubensbrueder und aller Dorfbewohner, so einen hundsmiserablen Saenger hab ich noch nicht gehoert. Und weil dies die dritte Nacht in Folge ist, die ich nicht richtig schlafen kann, moechte ich die Heulboje am liebsten mit einem Eimer Wasser uebergiessen. Diese Sirene haelt sich ueber eine Stunde dran, die Wellblechwaende des Schuppens hallen wieder. Und das alles, obwohl bei Sonnenaufgang gegen halb sieben ja wieder rezitiert werden muss. Vielleicht ist er ja auch derart sauer, dass er dauernd aufstehen und voellig verschlafen singen muss, dass er allen anderen rachsuechtig den Schlaf verleiden will. Zum Fruehstueck gibt es den Rest des Eintopfs von gestern, der mir gut schmeckt, weil er durch die Bananen suess ist. Die braune Farbe und pampige Konsistenz muss man halt ignorieren, ein Augenschmaus ist es eben nicht. Dazu trinken wir Schai, der aus mit Wasser verduennter Ziegenmilch, schwarzem Tee und braunem Zucker besteht. Der Knecht hackt im Feld und repariert das wenige Werkzeug, mit dem dies bearbeitet wird. Anders als in Aethiopien, haben hier die Hacken wenigstens Eisenkoepfe. Der Wassergraben ist fertig und jetzt kann die Regenzeit ruhig kommen, die jetzt nach und nach intensiver wird und bis in den Mai hinein andauert. Die Ziegen rupfen Maisstroh, ein paar Eidechsen laufen mit ruckelnden Bewegungen umher, agil geworden durch die Sonne, Katze und Hunde schlafen erschoepft vom naechtlichen Jagen und Bellen, im Schatten, es riecht nach Kraeutern und heisser Sonne und Feuer, denn im Kuechenschuppen wird eine kleine Kochstelle betrieben, auch hier ohne Rauchabzug. Warum die Leute sich das antun, bleibt mir schleierhaft: keine Oeffnung im Dach, keine Fenster, alles ist gluehend heiss und voellig verqualmt und dunkel. Mary hat Dan zur Schule gebracht und ihn angelogen, weil er sagte, wenn sie zurueck nach Nanyuki fuehre, wuerde er nicht zur Schule gehen. Der Junge sieht seine Mutter so selten, dass er sie natuerlich jetzt lange bei sich haben moechte, auch wenn er seine Tante ebenfalls Mama nennt. Gegen fuenf Uhr wird er von der Schule kommen (mancher deutsche Schueler moege sich diese Unterrichtsdauer mal auf der Zunge zergehen lassen!), um festzustellen, dass seine Mutter ihn angelogen hat. So macht man das, der Einfachheit halber geht man den unangenehmen Wahrheiten aus dem Weg, oder luegt eben. Das bringt Mary ihrem Sohn gerade bei. Ich gebe Sally etwas Geld fuer die Behandlung der verletzten Hand. Sie versucht uns trickreich doch noch zum Bleiben zu bewegen, moechte uns laenger hierbehalten, auch die Soehne haben sie gebeten, den Musungu zu ueberreden. Ich umarme die Frau spontan, die so nett und freundlich ist und Waerme um sich verbreitet. Wir gehen die 2 km zur Strasse zurueck, durch die gruene Landschaft voller Obstbaeume und wuchernder Hecken, aus denen es zwitschert und floetet, dass man sich im Paradies waehnt. An der Strasse ein kleiner Pub, indem sich der Dorfvorsteher und zwei Lehrer gerade ein paar Tusker-Bierchen hinter die Binde kippen. Mary und ich werden gleich eingeladen und ich muss von Deutschland erzaehlen, von Haustieren (was? Millionen von Katzen und Hunden? Im Haus? Allein mit Kindern?), von Gerhard Schroeder, dessen Name und das Ansehen Deutschlands auch in Subsahara-Afrika jetzt leuchten, weil wir "Nein" zum Krieg gegen den Irak gesagt haben. Auch die Christen betrachten Baby Bush und Big Dick Cheney als gefaehrliche Maenner und hoffen auf einen Wahlsieg Kerrys in den USA. Ich habe noch keinen einzigen Afrikaner gehoert, der die jezige Politik der USA gutheissen wurde. Auch Nairobi und Daressalam hatten 1998 verheerende Terroranschlaege zu verkraften, aber die Reaktion der Kenianer ist Einsicht, nicht Aggression. In einem Taxi rasen wir ueber die loechrige Teerstrasse zurueck nach Meru. Der Wagen hat hinter der Fahrerkabine, in der noch zwei Passagiere sitzen, hinten zwei Baenke, auf denen je vier Leute sitzen. Es gibt hier sogar Sicherheitsgurte, die aber fast alle defekt sind. Wenn ein Fahrgast aussteigen will, klopft der Kassierer, der an der Tuere sitzt, mit einer Muenze an eine der Haltestangen und der Fahrer hoert dies ueber die Karosserie. Regenwolken sind aufgezogen, der Mt. Kenia huellt seine Gipfel in graue Schleier. In Meru steigen wir um, dann geht es um den Berg herum zurueck. Es beginnt leicht zu regnen, die Sonne wirft wandernde Lichtteppiche auf die Weizenfelder voller Schafe, die wie braune Knoepfe auf einem gelben Tuch in der Landschaft stehen. Die bewaldeten Haenge des Berges, die Wiesen, dazwischen die fette, rote Erde, all das macht einen derart fruchtbaren Eindruck, dass ich eine unerklaerliches Gefuehl von Dankbarkeit und Freude empfinde. Hier muss niemand hungern, dass macht die Menschen ruhiger, gelassener. Aber nur 100, 200 km noerdlich von hier, in der Halbwueste, den Stammesgebieten der Samburu, Rendille, Turkana u.a. sieht das anders aus. So nah, dass man mit dem Fahrrad hinfahren kann, und doch so weit weg. Die Menschen am Strassenrand sind bunt gekleidet, die Frauen tragen Sonnen-Regenschirme, Huete, Zoepfe, Fahrradfahrer radeln mit ihren blauen Hollandraedern aus Indien, geschmueckt mit Wipfeln, Spiegeln, Klingeln und allerlei Tand, umher, mancher hat auf dem Gepaecktraeger Stapel von Holz, Wasserkanister oder Gemuesekisten voller Tomaten, Bohnen u.ae. Wir passieren eine rauchende Abfallhalde, auf der eine grosse Pavianherde alles Essbare herausklaubt. Die Matatus rasen wie die Irren, bergab, mit 14 Insassen, miserablen Bremsen und Stossdaempfern, ueberall kuenden Glassplitter und verbogene Brueckengelaender von den Folgen. Ein Bus, der hier durchs Gelaender stuerzt, hat meist keine Uberlebenden. Ueber 5000 Kenianer sterben jaehrlich durch Autounfaelle- ein Krieg und seine Opfer, die man auch hier als unabwendbares Schikcsal hinnimmt. Zumindest ist hier die zulaessige Anzahl der Passagiere auf den Autos aussen deutlich vermerkt. In Nanyuki esse ich mit Mary in einem Lokal ein Curry-Stew, mit frischem Ingwer und Basmatireis zubereitet, ein Erbe der englisch-indischen Einwanderer. Das Netcafe hat geschlossen. Im Hotel unterhalte ich mich mit dem Eignerehepaar Silvia und Josef in deren Buero, wo auch mein Fahrrad steht. Auch in dieser Nacht wenig Schlaf. geschrieben am 6.4. in Nanyuki
|